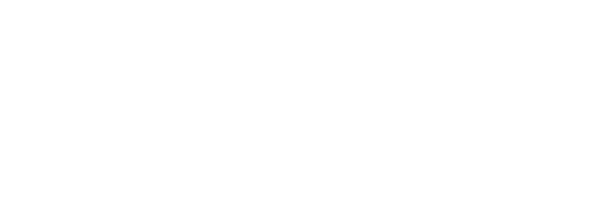Gamification in der Fitness- und Gesundheitsbranche
(c) Shutterstock
Bar ohne Namen
Entschlossen verweigert sich Savage, der Bar einen Namen zu geben. Stattdessen sind drei klassische Design-Symbole das Logo der Trinkstätte in Dalston: ein gelbes Quadrat, ein rotes Viereck, ein blauer Kreis. Am meisten wurmt den sympathischen Franzosen dabei, dass es kein Gelbes-Dreieck-Emoji gibt. Das erschwert auf komische Weise die Kommunikation. Der Instagram Account lautet: a_bar_with_shapes-for_a_name und anderenorts tauchen die Begriffe ‘Savage Bar’ oder eben ‚Bauhaus Bar‘ auf.
Für den BCB bringt Savage nun sein Barkonzept mit und mixt für uns mit Unterstützung von Russian Standard Vodka an der perfekten Bar dazu.
Um Kunden eines Fitnessstudios oder Nutzende einer Studio-App wirksam zu motivieren, weiter zu trainieren, gestalten viele Studiobetreibende und Entwickler die Angebote spielerisch, damit das Training mehr Spaß macht. Jedoch reicht der Spaßfaktor möglicherweise nicht aus, um die Kunden zu motivieren, ihre Anstrengungen aufrechtzuerhalten. In der Praxis wird dafür immer häufiger auf Gamification gesetzt. Passgenau gestaltet, können Gamificationelemente helfen, die Kunden zu motivieren, zu binden und Fitnessziele zu erreichen.
Was ist Gamification?
Gamification (oder Gamifizierung) ist ein Begriff aus dem Bereich der Mensch-Maschine-Interaktion und hat sich zu einem vielgenannten Ausdruck in der heutigen Medienlandschaft entwickelt. Sie kann als ein Prozess des spielerischen Denkens und eine Spielmechanik beschrieben werden, um Nutzende zu involvieren und Probleme zu lösen. In der Praxis findet man dieses Konzept schon häufig bei Fitnesschallenges, in denen Teilnehmende in Gruppen gegeneinander antreten. Das Ziel ist es beispielsweise, mehr Kilometer als die anderen zu laufen, mehr Kalorien zu verbrauchen oder auch mehr Gewicht zu bewegen.
Gamificationkonzepte lassen sich allerdings nicht nur auf sportliche Aktivitäten übertragen. Darunter fallen auch Punktesysteme, wie Abzeichen und Erfolge, sowie die Verwendung von Stufen und Erfahrungspunkten, um den Fortschritt anzuzeigen. Obwohl der Begriff noch neu ist, findet sich das Konzept schon seit einigen Jahren bei verschiedenen Loyalitätsprogrammen wie „Vielfliegerpunkten“ oder „Treuepunkten“ im Einzelhandel. Diese Gamificationprogramme können dazu führen, dass sich das Verhalten von Benutzern verändert – sie einen Service häufiger und intensiver wahrnehmen, um vorgegebene Ziele zu erreichen und damit externe Belohnungen zu erhalten.
Motivation durch Gamification
Sport und Fitness sind schon immer Trendthemen im Bereich der Gamification, da es Menschen hier häufig schwerfällt, sich zu motivieren. Forscher unterscheiden dabei zwischen extrinsischer und intrinsischer Motivation.
Intrinsische Motivationen sind jene, die jemanden durch das innere Selbst antreiben. Hier handelt die Person, weil sie die Aktivität sinnvoll findet, auch wenn es keine garantierte Belohnung gibt. Extrinsische Motivationen hingegen spornen an, weil das Ziel zu externen Belohnungen führt, wie Geld, sozialer Status oder Leistungspunkte. Viele Running-Apps versuchen Menschen so zu motivieren: Die intrinsische Motivation besteht zum Beispiel darin, aktiv zu bleiben oder schneller zu laufen. Die extrinsische Motivation kann – je nach Person – die Punktebelohnung oder die Teilhabe an der Gemeinschaft sein, die sie umgibt.
Anwendungsbeispiele für Gamification
Das Konzept der Gamification beinhaltet unterschiedliche Kernelemente, die zur Motivation angewendet werden können.
Punkte sind dabei eine absolute Voraussetzung für alle gamifizierten Systeme, auch wenn diese Punkte für Benutzer nicht immer sichtbar sind. Sie offenbaren, wie die Nutzenden mit dem System interagieren, und unterstützen dabei, im Laufe der Zeit entsprechende Anpassungen der angebotenen Produkte und Dienstleistungen vorzunehmen. Punkte können konkreten Werten, wie Geld oder sozialem Status (z. B. Premiummitgliedschaft im Fitnessstudio), entsprechen oder auch als Spielpunkte, wie Erfahrungs- oder Geschicklichkeitspunkte, gezählt werden. So könnten beispielsweise Punkte für jeden Besuch im Fitnessstudio, jedes gekaufte Getränk oder jedes Upgrade der Mitgliedschaft vergeben werden.
Level (oder Stufen) zeigen einen Fortschritt an. Sie veranschaulichen den Benutzern, wie „gut“ sie sind und wo sie sich im System befinden. Sie müssen nicht wie in Videospielen verwendet werden, aber ohne sie gibt es keinen Fortschritt. Mit steigendem Level sollte der Schwierigkeitsgrad der Herausforderung erhöht werden, um die Motivation weiterhin aufrechtzuerhalten. Die Level oder Stufen können sich nach den erreichten Punkten richten oder über eine andere Variable (z. B. die Mitgliedschaftsdauer) abgebildet werden. Das Erreichen einer Stufe bzw. eines Levels kann mit bestimmten Prämien (z. B. Freigetränke, kostenloses Mitbringen eines Trainingspartners) oder Rabatten versehen werden, um damit neue Anreize zur Bindung der Klientel oder zur Gewinnung neuer Kundschaft zu setzen.
Challenges und Aufgaben geben Nutzenden einen Sinn für das, was sie im Rahmen der Aktivität tun. Sie machen die Aktivität unterhaltsamer und lohnender, wodurch eine gewisse Tiefe und Bedeutung hinzugefügt wird. Eine Herausforderung wäre es z. B., für ein Jahr mindestens einmal die Woche das Fitnessstudio zu besuchen. Eine Belohnung für diese Herausforderung könnten dann ein spezielles Abzeichen, Rabatte oder Gutscheine vom Studio sein. Für diese Challenges sind auch interne Ranglisten denkbar, die im Studio einsehbar sind. Solche Challenges müssen aber nicht zwingend allein absolviert werden, sondern können auch in Teams oder als gesamtes Studio gemeistert werden, was die soziale Interaktion steigert. Allerdings müssen die Inhalte solcher Challenges immer vorsichtig ausgewählt werden, da manche Herausforderungen möglicherweise zu ungesunden Verhaltensweisen führen können, wie beispielsweise übermäßiges Training mit zu kurzen Regenerationsphasen oder eine zu geringe Kalorienzufuhr bei einer Diätchallenge.
Anhand von Ranglisten können sich die Nutzenden miteinander vergleichen. Es gibt zwei Arten von Ranglisten: die anreizlose Rangliste, die nur teilweise angezeigt wird und Benutzer in der Mitte dieser stehen, und die unendliche Rangliste, bei der alle Anwendenden angezeigt werden, die aber in kleinere separate Ranglisten unterteilt werden kann wie z. B. in Altersgruppen, nach Geschlecht oder Professionalität. Solche Ranglisten könnten zum Beispiel öffentlich im Studio ausgehangen oder in der eigenen Studio-App abgebildet werden, um die Ergebnisse der letzten Challenges (Klimmzugchallenge, größte Körperfettreduktion, beste Zeiten beim Laufevent etc.) zu präsentieren.
Abzeichen werden schon seit Langem in anderen Kontexten verwendet wie z. B. beim Militär oder auch beim Sport. Die Verwendung von Abzeichen ist ein mächtiges Werkzeug, um Teilnehmende zu etwas zu ermutigen oder zu motivieren. Das menschliche Verhalten hat gezeigt, dass wir dazu neigen, Dinge zu sammeln und für Aktionen belohnt werden zu wollen. So könnten beispielsweise Abzeichen für das Erreichen bestimmter Meilensteine der körperlichen Fitness oder Gesundheit vergeben werden (z. B. Körperfettanteil und Blutdruck im Normalbereich, eine bestimmte Anzahl von Klimmzügen oder das Unterschreiten einer bestimmten Zeit beim Zehnkilometerlauf).
Über den Autor
Prof. Dr. Marco Speicher
Prof. Dr. Marco Speicher leitet den Fachbereich Informatik an der DHfPG. 2019 promovierte er an der Universität des Saarlandes zum Thema „Measuring User Experience for Virtual Reality“. Von 2014 bis 2019 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter und Doktorand am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) und dort im Ubiquitous Media Technologies Lab (UMTL) und Innovative Retail Laboratory (IRL) tätig.
Dieser Artikel erschein zunächst in der Fitness Management.
Auszug aus der Literaturliste
Koivisto, J. & Hamari, J. (2019). Gamification of physical activity: A systematic literature review of comparison studies. International GamiFIN Conference 2359, 106–117.
Leslie, E., McCrea, R., Cerin, E. & Stimson, R. (2007). Regional Variations in Walking for Different Purposes: The South East Queensland Quality of Life Study. Environment and Behavior, 39 (4), 557–577.
Zichermann, G. & Cunningham, C. (2011). Gamification by Design: Implementing Game Mechanics in Web and Mobile Apps (1st ed.). Sebastopol, CA: O'Reilly Media.
Für eine vollständige Literaturliste kontaktieren Sie bitte [email protected].